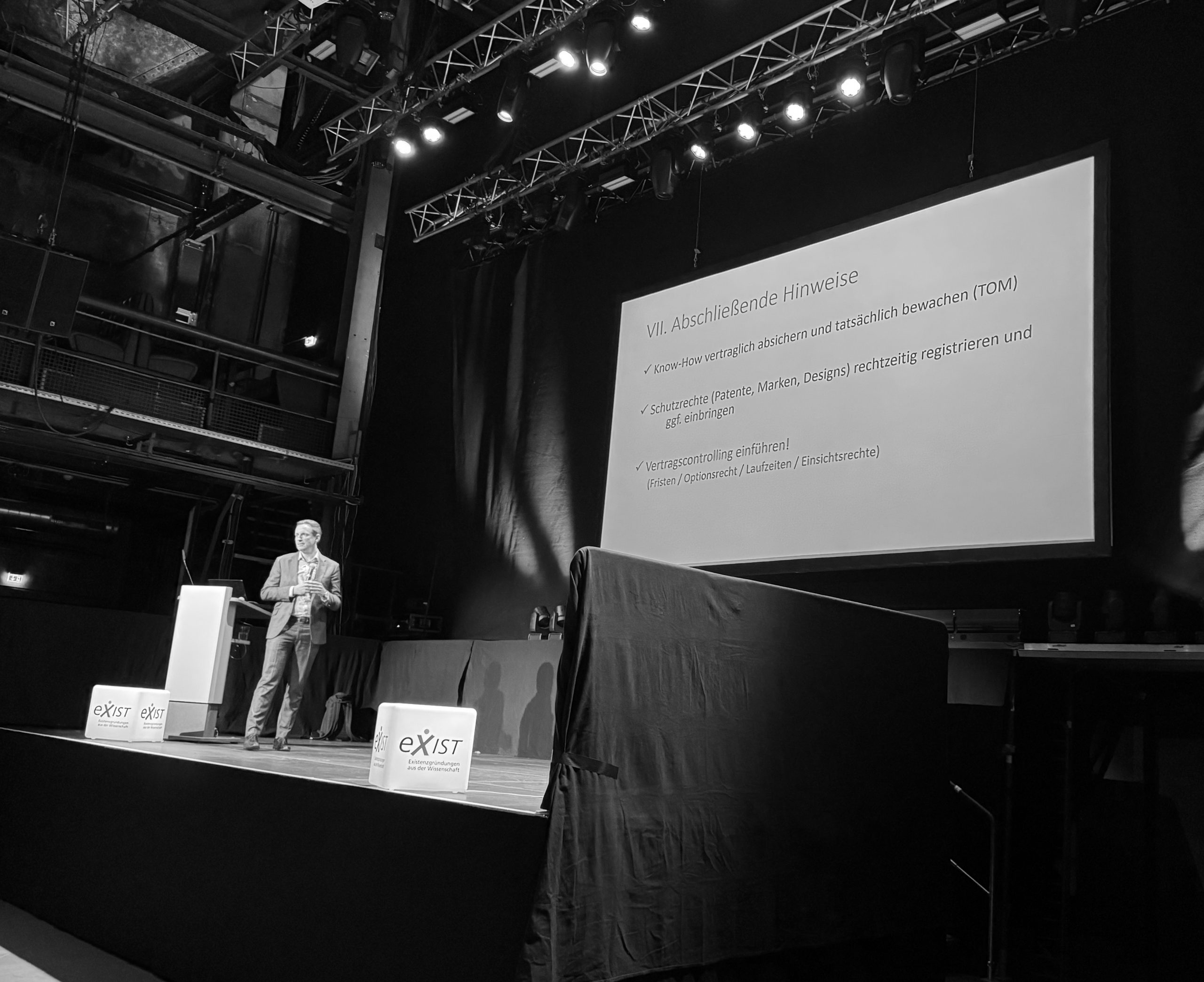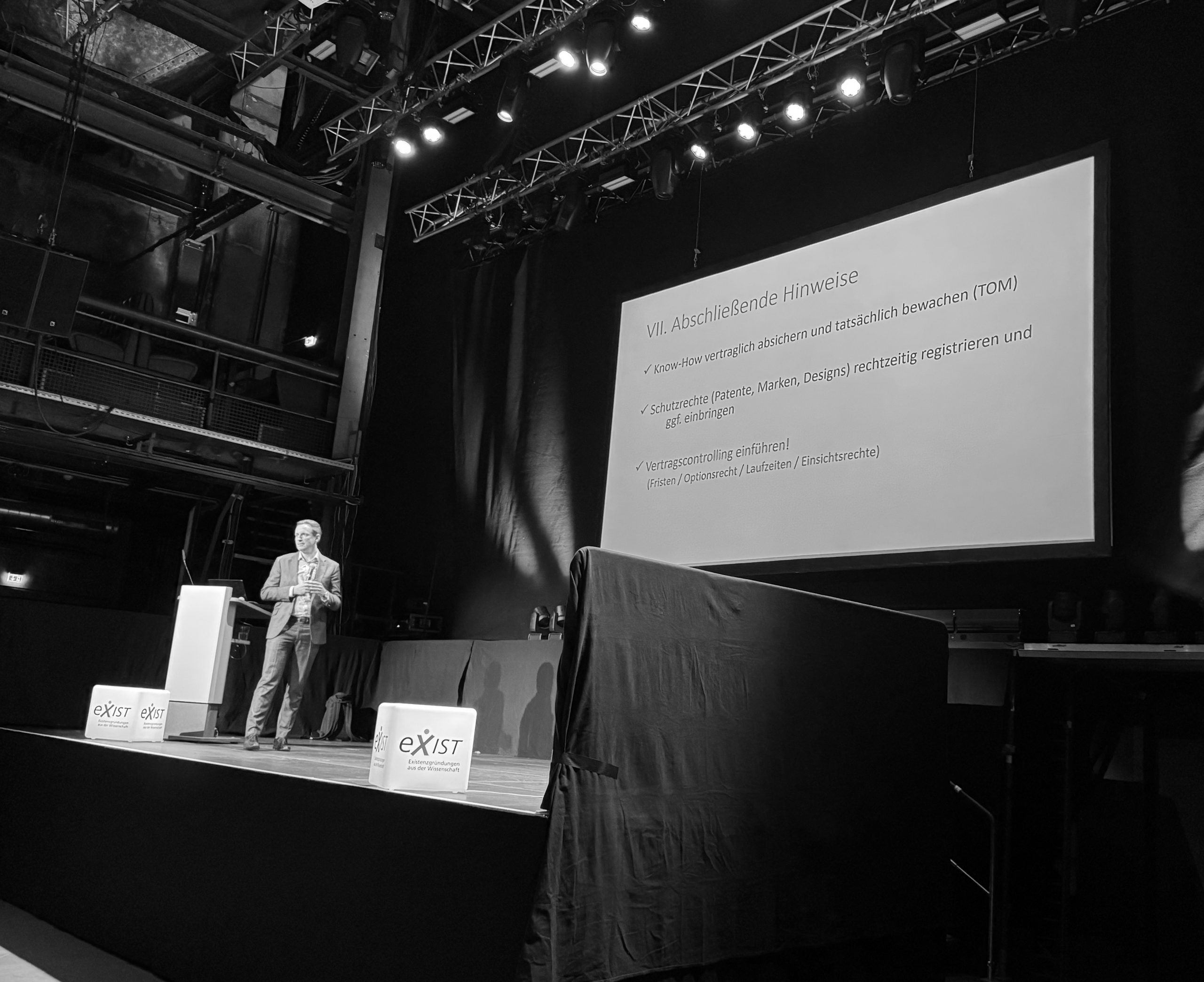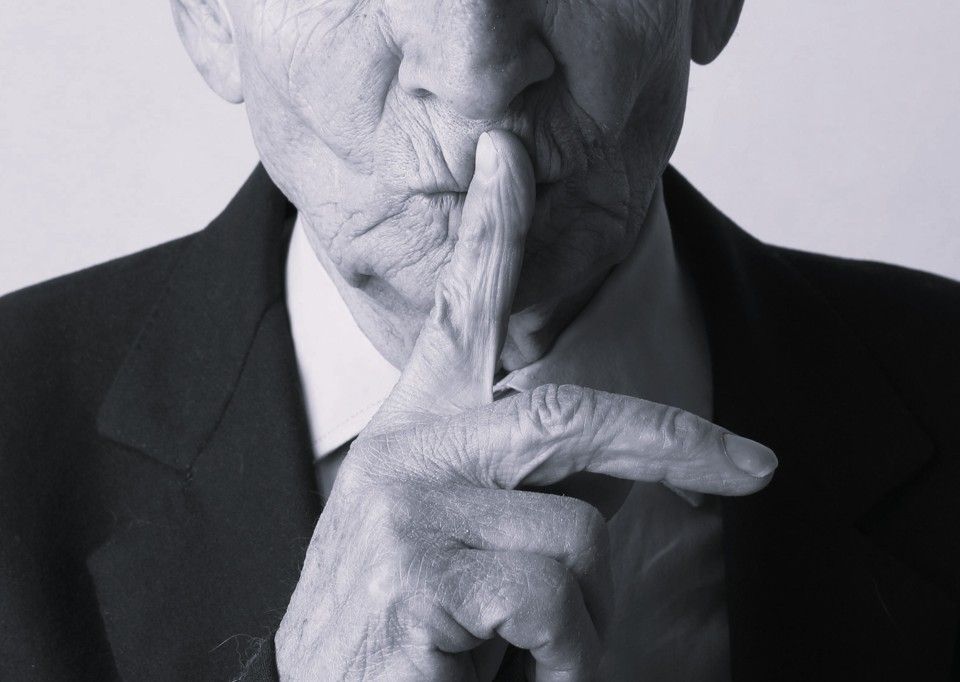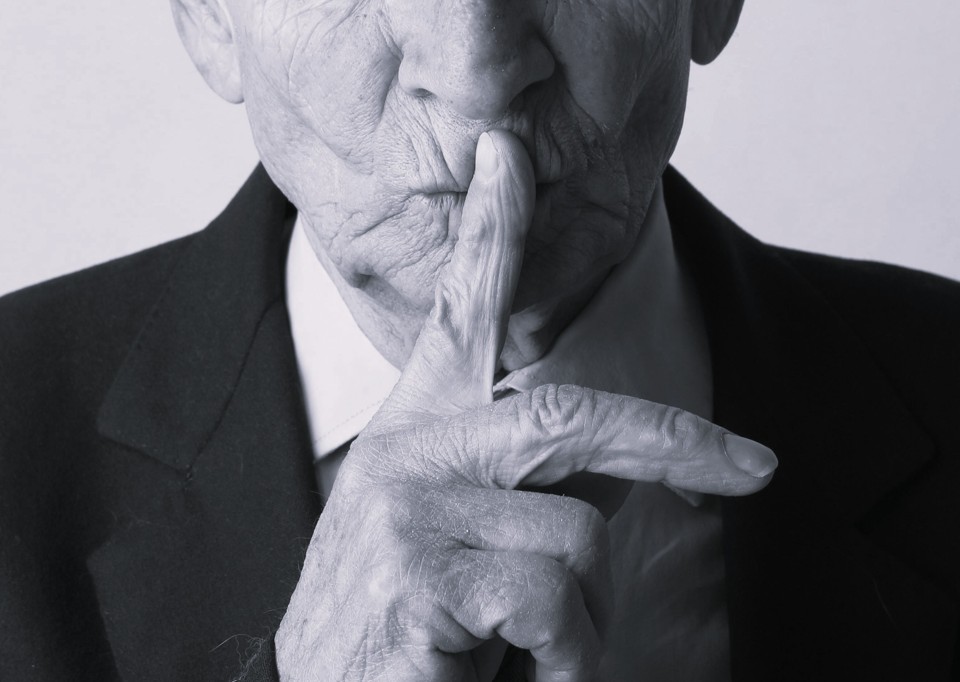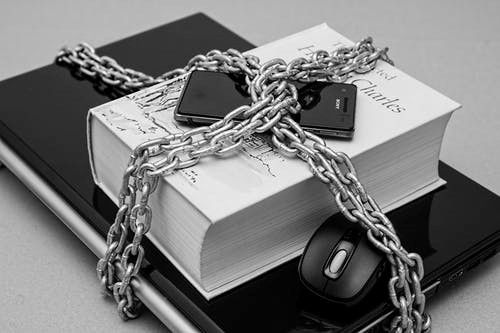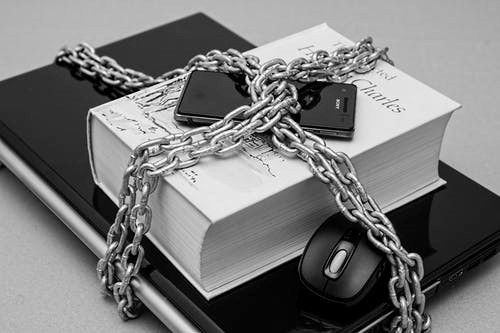Die Kündigung eines angestellten Geschäftsführers
Außerordentlicher Kündigungsgrund: Die Liquidation der GmbH
Welche Kündigungsfristen sind auf Dienstverhältnisse von Geschäftsführern, die keine Mehrheitsgesellschafter sind, anzuwenden?
Das aktuelle BGH-Urteil vom 05.11.2024 (AZ: II ZR 35/23) beantwortet zentrale Fragen rund um die Kündigung eines Geschäftsführeranstellungsvertrages aus vertraglich vereinbartem außerordentlichem Grund und stärkt dabei den Schutz von Geschäftsführern einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die keine Mehrheitsgesellschafter sind. Wir erläutern Ihnen im Rahmen dessen, was die Liquidation der GmbH bedeutet und wann eine Gesellschaft rechtlich beendet ist.

Diese Antworten gibt der BGH:
Bei einer außerordentlichen Kündigung des Anstellungsvertrags des Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgrund vertraglich vereinbarter wichtiger Gründe gilt die zweiwöchige Erklärungsfrist des § 626 Abs. 2 BGB. Auf den Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der kein Mehrheitsgesellschafter ist, sind die zum Nachteil des Geschäftsführers grundsätzlich nicht abdingbaren, in § 622 Abs. 1 und 2 BGB geregelten Kündigungsfristen entsprechend anzuwenden, so der Bundesgerichtshof. Dies gilt auch dann, wenn er Geschäftsführer der Komplementärin einer GmbH & Co. KG ist und den Anstellungsvertrag unmittelbar mit der Kommanditgesellschaft abgeschlossen hat (Abgrenzung zu BAG, Urteil vom 11. Juni 2020 – 2 AZR 374/19, BAGE 171, 44).
Ist ein Geschäftsführeranstellungsvertrag ein Arbeitsvertrag?
Diese umstrittene Frage beantwortet der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem Urteil zwar nicht in der Deutlichkeit, spricht sich aber für die auf Arbeitsverträge anwendbare Vorschrift des § 622 BGB in entsprechender Anwendung für Geschäftsführerdienstverträge aus. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hingegen sieht das anders und wendet stattdessen § 621 BGB an, vgl. Urt. vom 11. Juni 2020 – 2 AZR 374/19, BAGE 171, 44. Die arbeitsrechtliche Einordnung des angestellten Geschäftsführers ohne Mehrheitsbeteiligung neben seiner Organstellung bleibt damit weiterhin zwischen dem BGH und dem BAG umstritten.
Jedenfalls ergänzt der GAV aber die formelle Bestellung zur Geschäftsführung. Neben den Regelungen im GmbH-Gesetz, das bereits bestimmte Rechte und Pflichten des Geschäftsführers als Organ der Gesellschaft enthält, tritt der Geschäftsführervertrag, der die persönlichen Arbeitsbedingungen wie Gehalt, Urlaub, Krankenzeiten oder die Altersversorgung regelt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist der Geschäftsführer allerdings, unabhängig davon, ob es sich um einen Gesellschafter-Geschäftsführer oder um einen sogenannten Fremdgeschäftsführer handelt, gerade kein Arbeitnehmer im klassischen Sinn. Vielmehr vertritt der Geschäftsführer die GmbH als Organ und steht nicht in einem klassischen Abhängigkeitsverhältnis mit ihr. Diese Rechtsprechung ist allerdings im Wandel, wie sich zuletzt durch das zuvor benannte Urteil des BGH zeigt: Der BGH bejaht zunehmend die Arbeitnehmereigenschaft von Fremdgeschäftsführern bzw. Geschäftsführern mit nur geringem Gesellschaftsanteil vereinzelt, sofern sie ihrer Arbeit nicht selbstbestimmt nachgehen, sondern inhaltliche, zeitliche und örtliche Vorgaben von übergeordneten Führungskräften erhalten. So auch im nachfolgend besprochenen Urteil des BGH, das die Rechte von angestellten Geschäftsführern im Kontext der Kündigung stärkt. Zwischen dem Bundesgerichtshof und dem Bundesarbeitsgericht besteht damit fortwährend Uneinigkeit darüber, ob für Geschäftsführerdienstverträge § 622 oder § 621 BGB Anwendung findet.
BGH-Urteil vom 5. November 2024 – II ZR 35/23:
Sachverhalt:
Ein Geschäftsführer war seit 2001 bei einer GmbH & Co. KG tätig und schloss im Rahmen dessen mit der Kommanditgesellschaft einen Anstellungsvertrag (GAV) ab. § 4 Abs. 2 des GAV regelte die Kündigung aus wichtigem Grund, der u.a. die „Liquidation“ der Gesellschaft aufführte. Am 8. März 2016 bestimmte die Gesellschafterversammlung einstimmig die Liquidation. Gegen die Stimme des Klägers wird zudem die sofortige außerordentliche (hilfsweise ordentliche) Kündigung seines GAV beschlossen. Am 23. März 2016 ging dem Geschäftsführer die außerordentliche Kündigung mit Verweis auf die Liquidation zu. Am 7. Juni 2016 erhielt er eine weitere „vorsorgliche“ außerordentliche und ordentliche Kündigung. Die Parteien stritten über die Wirksamkeit der Kündigungen des GAV.
Entscheidung des BGH:
Nach Ansicht des BGH waren beide Kündigungen unwirksam:
Die erste wegen Nichtbeachtung der 2-Wochen Frist nach § 626 Abs. 2 BGB. Die Kündigung konnte nur innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis vom Vorliegen des Kündigungsgrundes (Gesellschafterbeschluss zur Liquidation) erfolgen. Die Frist verstrich am 22.03.2016, sodass die Kündigung am 23.03.2016 zu spät erfolgte.
Und die zweite Kündigung vom 07.06.2016 war mangels wichtigen Grundes unwirksam.
Der Geschäftsführer blieb in der Folge aus § 622 BGB entsprechend (ordentliche Kündigungsfristen) geschützt, der auch grundsätzlich nicht zum Nachteil des Geschäftsführers abdingbar sei. Dies gelte auch dann, wenn er Geschäftsführer der Komplementärin einer GmbH & Co. KG ist und den Anstellungsvertrag unmittelbar mit der Kommanditgesellschaft abgeschlossen hat (hierbei grenzt sich der BGH zum BAG (Urteil v. 11.6.2020 – 2 AZR 374/19) ab.
Die Liquidation der GmbH als vertraglich vereinbarter außerordentlicher Kündigungsgrund?
In dem Sachverhalt, der dem hier besprochenen Urteil des BGH zugrunde lag, definierte der GAV die Liquidation der Gesellschaft als wichtigen Kündigungsgrund. Eine weitere zentrale Aussage des BGH in seinem Urteil dazu lautete, dass vertragliche Abreden den gesetzlichen Begriff des wichtigen Grundes nicht aufheben können und folgt damit seiner ständigen Rechtsprechung, wonach vertraglich vereinbarte Klauseln den gesetzlichen Schutz des Geschäftsführers nicht unterlaufen dürfen. Die Liquidation allein genüge demnach nicht, um eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Vielmehr kommt es zusätzlich auch darauf an, ob die Fortführung des Anstellungsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist für den Arbeitgeber unzumutbar ist.
Das bedeutet die Liquidation der GmbH:
Die Liquidation einer GmbH ist ein komplexer Vorgang, der das Ziel verfolgt, die Gesellschaft zu beenden. Viele Schritte sind zu durchlaufen, bis es zur endgültigen Löschung der GmbH im Handelsregister kommt. Durch den Verkauf aller unternehmerischen Vermögenswerte wird versucht, alle Verbindlichkeiten vollständig zu begleichen und das verbleibende Vermögen zur Verteilung an die Gesellschafter in liquide Mittel umzuwandeln.
Der Abwicklungsprozess lässt sich im Wesentlichen in 3 Handlungsabschnitte unterteilen.
- Die Auflösung
- Die Abwicklung
- Die Löschung
Phase 1: Einleitung der Liquidation: Auflösung
Die Abwicklung der GmbH beginnt mit einer Gesellschafterversammlung, bei der die Liquidation auf die Tagesordnung kommt und ein ordnungsgemäßer Auflösungsbeschluss die Entscheidung der Gesellschafter widerspiegelt, die GmbH abwickeln zu wollen. Dieser Auflösungsbeschluss bedarf der notariellen Beglaubigung und muss beim zuständigen Registergericht am Sitz der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden, wodurch das Sperrjahr beginnt. Damit wird der Gesellschaftszweck von der aktiv werbenden Tätigkeit zur Abwicklung der laufenden Geschäfte geändert.
Phase 2: Liquidationsphase: Abwicklung
Sodann erfolgt die eigentliche Durchführung des Liquidationsvorhabens. An die Stelle der Geschäftsführer tritt der Liquidator, der den Abwicklungsprozess vollzieht. Die laufenden Geschäfte der GmbH werden eingestellt. Innerhalb des Sperrjahres sind alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu begleichen, Forderungen der GmbH einzuziehen und sämtliche Aktivposten zu liquidieren, sog. Versilberung des Vermögens. Anschließend erstellt der Liquidator eine Liquidationsüberschussbilanz, die Aufschluss über das an die Gesellschafter zu verteilende Vermögen ergibt. Die Verteilung darf jedoch erst erfolgen, wenn das Sperrjahr abgelaufen ist, damit die Gläubiger der GmbH ausreichende Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Ansprüche erhalten.
Phase 3: Beendigung und Löschung:
Mit Ablauf des Sperrjahres im Sinne von § 73 GmbHG tritt die Beendigung der GmbH ein, sofern kein verteilbares Vermögen mehr vorhanden ist oder sonstige Liquidationsmaßnahmen zu ergreifen sind. Der Abschluss der Liquidation muss ebenfalls ins Handelsregister aufgenommen werden. Daraufhin kann die Löschung der GmbH im Handelsregister vorgenommen werden, wodurch die GmbH ihre rechtliche Existenz verliert.
Ihre rechtssichere Beratung im Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht
Die Liquidation einer GmbH stellt Unternehmen, Gesellschafter und Geschäftsführer vor erhebliche rechtliche und strategische Herausforderungen. Wir stehen Ihnen dabei mit unserem Full-Service-Ansatz beratend zur Seite und bieten Ihnen zuverlässig Unterstützung durch alle Phasen des Liquidationsprozesses. Darüber hinaus vertreten wir Sie kompetent in allen Fragen rund um das Arbeitsrecht, sowohl auf der Seite des Unternehmers, Geschäftsführers oder auch Arbeitnehmers. Wir unterstützen Sie rechtlich im Umgang mit Geschäftsführeranstellungsverträgen, Kündigungen jedweder Art und bieten dabei maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Interessen wirksam schützen.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine persönliche und lösungsorientierte Beratung.

Benjamin von Allwörden
Rechtsanwalt | Partner
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Zum Profil

Dr. Sebastian von Allwörden
Rechtsanwalt | Partner | Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

Titus Wolf, B. Sc.
Rechtsanwalt | Partner